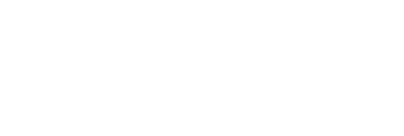Plenarvorträge
Allgemeines
Für Präsenz-Teilnehmer ist keine gesonderte Anmeldung für die Plenarveranstaltungen erforderlich. Die Teilnahme ist durch die Grundgebühr abgedeckt.
Die Plenarvorträge werden, wie auch der Abendvortrag und die durchlaufenden Vorlesungen, im Hybridmodus angeboten.
Öffnung von Denkräumen – Aufgaben und Probleme der Psychotherapie
Die Plenarvorträge der diesjährigen EPW fokussieren primär auf die Denkgebote und -verbote in der Gesellschaft und die Frage, wie es in diesem Kontext zu Polarisierungen kommt. Die Profession der Psychotherapie, der immer wieder mangelndes gesellschaftliches Engagement vorgeworfen wird, sollte sich an dem gesellschaftlichen Diskurs unbedingt mehr beteiligen. Allerdings gilt es auch, „vor der eigenen Haustüre“ der Profession zu kehren, wenn es um tabuisierte Themen und die Freiheiten geht, auch scheinbar längst geklärte Fragen offen zu diskutieren. Damit soll sich der Vortrag primär beschäftigen. Dabei wird es nötig sein, die Profession auch kritisch zu betrachten, etwa im Hinblick auf die Aufgeschlossenheit für Selbstkritik, die Perspektivübernahme, Offenheit für die Beteiligung an und die Rezeption von Forschungsfragen, „Lernbereitschaft“ und die Reflexion von Versorgungsproblemen in der Psychotherapie. Eine wesentliche Determinante von Denkverboten stellen die psychotherapeutischen Schulen und Verfahren dar, die gelegentlich immer noch den Prinzipien einer „autoimmunen Abwehr“ gleich, Impulse von außen abwehren. Schließlich gilt es, über den Stand eines Fehlerbewusstseins in der Psychotherapie und den Umgang mit Fehlverhalten zu diskutieren.
Bernhard Strauß ist Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie am Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist dort Professor für Medizinische Psychologie und Psychotherapie. Prof. Strauß ist Autor, Herausgeber und Schriftleiter zahlreicher Bücher, Fachzeitschriften (z. B. der Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, Psychotherapie) und Buchreihen. Er war Vorsitzender des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM), der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Psychologie (DGMP) und Präsident der Society for Psychotherapy Research (SPR). Von 2011 – 2018 war er Kollegiat der DFG für das Fachgebiet Klinische, Differentielle und Diagnostische Psychologie, Medizinische Psychologie. Derzeit ist er Kovorsitzender des wissenschaftlichen Beirates Psychotherapie der Bundesärzte- und der Bundespsychotherapeutenkammer.
Aktuelle Buchveröffentlichungen:
- Strauß B, Spitzer C: Psychotherapeuten und das Altern – Die Bedeutung des Alterns in der therapeutischen Beziehung und der eigenen Lebensgeschichte. Springer, Heidelberg, 2023
- Kirschner H, Forstmeier S, Strauß B: Das Lebensrückblickgespräch. Hintergründe, Wirkungsweise und praktische Anleitung. Psychosozial-Verlag, Gießen 2022
- Strauß B, Erices R, Guski-Leinwand S, Kumbier E: Seelenarbeit im Sozialismus. Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie in der DDR. Psychosozial, Gießen, 2022
- Strauß B: Gruppenpsychotherapie. Grundlagen und integrative Konzepte. Kohlhammer, Stuttgart, 2022
Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Universitätsklinikum Jena, Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie, Stoystr. 3, 07740 Jena
E-Mail:bernhard.strauss@med.uni-jena.de
Website: www.mpsy.uniklinikum-jena.de/Institut.html
Wer für Meinungsfreiheit kämpft, muss bei der Gedankenfreiheit anfangen
Debatten über Meinungsfreiheit haben Konjunktur. Die einen sehen sie bedroht. Sie fühlen sich drangsaliert von Political Correctness und Cancel-Culture. Andere wittern in diesen Schlagworten Kampfbegriffe, mit denen versucht wird, die Demokratie zu untergraben. Natürlich wissen alle Beteiligten, dass es nur am Rande um Meinungsfreiheit geht, wenn von Meinungsfreiheit die Rede ist. Im Grunde geht es um gesellschaftliche Deutungshoheit. Wer bestimmt, welche Meinungen legitim sind, und wer festlegt, wo die Grenzen des Sagbaren liegen, der hat die Macht über die öffentliche Meinung. Und wer in einer Mediengesellschaft die Macht über die öffentliche Meinung hat, bestimmt die Agenda des politischen Handelns. Über Meinungsfreiheit zu reden, ist deshalb wichtig. Es geht um das entscheidende Grundrecht jeder Demokratie. Je enger die Grenzen des Sagbaren gesteckt sind, desto autoritärer ist eine Gesellschaft, auch wenn sie formal demokratisch ist. Vor allem aber wird das Recht auf Meinungsfreiheit dann zur Makulatur, wenn die Menschen qua Medien, Werbung und Konsumgütern einer meinungsbildenden Dauerbeschallung unterliegen, die eine freie Meinungsbildung deutlich erschwert. Wer für Meinungsfreiheit kämpft, muss bei der Gedankenfreiheit anfangen. Denn wenn alle ohnehin nur noch eine Meinung haben, braucht es keine Meinungsfreiheit mehr.
Alexander Grau, geboren 1968 in Bonn, studierte nach seinem Wehrdienst Philosophie, Sprachwissenschaften und Neue Geschichte an der Freien Universität Berlin. 1998 wurde er mit seiner Dissertation Ein Kreis von Kreisen. Hegels postanalytische Erkenntnistheorie an der FU-Berlin promoviert.
Im Jahr 2002 ging er mit einem Forschungsstipendium der Fritz-Thyssen-Stiftung an das Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 2003 arbeitet Alexander Grau als freier Journalist, Publizist und Essayist zunächst für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, später für das Magazin Cicero, die Neue Züricher Zeitung und die Weltwoche. Seit 2015 schreibt er die jeden Samstag erscheinende Kolumne „Grauzone“ für Cicero-online. Artikel von ihm sind darüber hinaus erschienen in: Der Spiegel, Gehirn & Geist, chrismon, epoc, brand eins usw. Zudem veröffentlicht er regelmäßig Radioessays u.a. beim Deutschlandfunk und Südwestfunk.
Buchveröffentlichungen:
- Ein Kreis von Kreisen. Hegels postanalytische Erkenntnistheorie. mentis, Paderborn 2001.
- (mit G. Raabe): Religion. Facetten eines umstrittenen Begriffs. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2014.
- Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung. Claudius Verlag, München 2017.
- Kulturpessimismus. Ein Plädoyer. Zu Klampen, Springe 2018.
- Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität. Claudius Verlag, München 2019.
- Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle. Zu Klampen, Springe 2022.
- Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit, Claudius Verlag, München 2024
Philosoph, arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist
Wie das Streben nach gesellschaftlicher Transformation intellektuelle Unfreiheit befördert
Offenheit gegenüber Erkenntnissen, Argumenten und Meinungen, die den eigenen Wissens- und Überzeugungsrahmen herausfordern, ist vielen Menschen nicht in die Wiege gelegt. Denn: Der Verbleib in einer intellektuellen und emotionalen Komfortzone ist angenehmer, als deren Verlassen. Um in der Komfortzone verbleiben zu können, stehen Menschen unterschiedliche Optionen zur Verfügung: die Meidung Andersdenkender, die Erzeugung von Konformitätsdruck und – sofern sie die Macht dazu haben – die Bestrafung und Verfolgung Andersdenkender. Um die freiheitsfeindlichen Folgen dieser Disposition zu begrenzen, wurde im Grundgesetz in Artikel 5 die Meinungsfreiheit sowie zur Absicherung der intellektuellen Entfaltung von Wissenschaftlern die Freiheit von Forschung und Lehre verankert. Nur: Wie alle Grundrechte leben auch die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit von Voraussetzungen, die der Staat allein nicht garantieren kann. Damit diese Freiheitsrechte im öffentlichen Diskurs und im Wissenschaftsbetrieb ohne Angst vor moralischer Stigmatisierung, sozialer Ausgrenzung und ohne Sorge um berufliche Konsequenzen in Anspruch genommen werden können, bedarf es auch eines gesellschaftlichen sowie institutionellen Klimas der Freiheit, für das alle Beteiligten verantwortlich sind.
Der Vortrag analysiert, warum es um dieses Klima in den letzten Jahren nicht allzu gut bestellt ist. Er verortet die zentrale Ursache dafür in Weltanschauungen, die im Namen identitätspolitischer Gerechtigkeitsideale sowie der „Klimarettung“ auf die Transformation der Gesellschaft abzielen. Weltanschaulich motivierte Wissenschaftler, die Forschung und Lehre in erster Linie als Instrumente der gesellschaftlichen Transformation betrachten, zeichnen sich oftmals durch Unduldsamkeit gegenüber Andersdenkenden aus. Der Vortrag zeigt auf, mit welchen Mitteln dieser Wissenschaftlertypus vorgeht, warum man ihn allzu oft gewähren lässt und welche Folgen sein Agieren für andersdenkende Wissenschaftler, für eine ergebnisoffene Erkenntnisgewinnung und letztlich auf für die Funktionsfähigkeit des Wissenschaftssystems hat.
Sandra Kostner studierte Geschichte und Soziologie an der Universität Stuttgart und promovierte 2009 an der University of Sydney. Seit 2010 ist sie Geschäftsführerin des Masterstudiengangs „Migration, Diversität und Teilhabe“ an der PH Schwäbisch Gmünd. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Migrations- und Integrationspolitik, Geopolitik sowie Transformationspolitik und deren Folgen für Demokratie, individuelle Freiheitsrechte und Rechtsstaat.
Aktuelle Publikationen:
- Die Wir-gegen-die-Gesellschaft. Warum der von Arthur M. Schlesinger vor 30 Jahren diagnostizierte Samen der identitätspolitischen Spaltung aufgegangen ist (ibidem, 2024)
- (hg. mit Stefan Luft), Ukrainekrieg. Warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht (Westend, 2023)
- Wissenschaftsfreiheit. Warum dieses Grundrecht zunehmend umkämpft ist (Nomos, 2022)
- (hg. mit Tanya Lieske), Pandemiepolitik. Freiheit unterm Rad? Eine interdisziplinäre Essaysammlung (ibidem, 2022)
- (hg. mit Elham Manea), Lehren aus 9/11. Zum Umgang des Westens mit Islamismus (ibidem, 2021)
Publizistin, Geschäftsführerin des Masterstudiengangs „Interkulturalität und Integration“ an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.
Zur Belastbarkeit und Beeinflussbarkeit von Erinnerungen
Erinnerungen sind identitätsstiftend – wer wir sind und wie wir sind hängt maßgeblich davon ab, wie wir unsere Vergangenheit repräsentiert haben. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, unseren Erinnerungen dabei (vollkommen) trauen zu können, sind unsere Erinnerungen jedoch höchst fehlbar und erschreckend leicht beeinflussbar. Dies zeigt sich spätestens in der Tatsache, dass Menschen innerhalb weniger Interviews Erinnerungen an tatsächlich nicht erlebte Ereignisse entwickeln können. Die Konsequenzen solch falscher Erinnerungen können – gerade auch im therapeutischen Kontext – gravierend sein. Der Vortrag beleuchtet daher einige der Prozesse, über die ein Einfluss auf Erinnerungen erfolgen kann und soll insbesondere auch für das Risiko von Suggestion im therapeutischen Kontext sensibilisieren, da dieser eine für falsche Erinnerungen besonders förderliche Konstellation darstellt. Darüber hinaus werden auch einige Mythen und falsche Vorstellungen über das menschliche Gedächtnis thematisiert und nicht zuletzt Empfehlungen und Techniken zur Umkehr von Einflüssen auf die Erinnerungen vorgestellt.
Prof. Dr. Aileen Oeberst ist Diplom-Psychologin und Professorin für Medienpsychologie an der FernUniversität in Hagen. Sie studierte an der Universität Leipzig sowie der Università degli studi di Cagliarì (Italien), promovierte anschließend an der Universität Osnabrück. 2011 ging sie an das Leibniz-Institut für Wissensmedien nach Tübingen, 2016 wurde sie auf die Junior-Professur für Forensische Psychologie an die Universität Mainz berufen, wo sie bis zu ihrem Ruf auf die ordentliche Professur nach Hagen 2019 blieb. Ihre Schwerpunkte liegen in der Erforschung von Verzerrungen in der Informationsverarbeitung, Urteilsfehlern, der Beeinflussbarkeit des Gedächtnisses und der Reversibilität von Einfluss, falschen Erinnerungen sowie Aspekten der Glaubhaftigkeitsbegutachtung. Sie ist Mitglied der ExpertInnenkommission zum Thema „Therapie und Glaubhaftigkeit“ des Bundesjustizministeriums.
Sie ist Autorin zahlreicher Aufsätze in internationalen Fachzeitschriften, wie beispielsweise zur Suggestion und Reversibilität von falschen autobiographischen Erinnerungen (https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2026447118) sowie zu einer integrativen Erklärung für eine Reihe von Urteilsfehlern (https://journals. sagepub.com/doi/10.1177/17456916221148147).
Professorin für Medienpsychologie
Meinungsfreiheit und Freedom of Speech: Über Denk- und Debattenräume in Deutschland und den USA
Konzeption und Praxis der Redefreiheit in den USA erscheinen aus deutscher Sicht extrem liberal. Der Vortrag wird die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes und Freedom of Speech, die Redefreiheit der amerikanischen Verfassung, anhand einiger Grundsatzurteile darstellen. Im Vergleich treten Gemeinsamkeiten zutage, teilweise aber auch drastische Unterschiede.
Demokratie lebt von Diskussion, das heißt von friedlich ausgetragenen, nicht stillzustellenden Konflikten. Eine deutsche „Streitkultur“, die diesen Namen verdient, kann getrost Anleihen beim amerikanischen Verständnis von „public discourse“ machen. Denn die öffentliche Debatte soll, wie der US-Supreme Court formulierte, „unbehindert, robust und weit offen“ sein. Mit dem gleichen Tenor erklärte das Bundesverfassungsgericht, im Zweifel werde die Freiheit der politischen Rede vermutet, und seine Rechtsprechung stellt das beeindruckend unter Beweis. Gleichwohl beschränkt es bis heute Meinungsäußerungen, die bloß abstrakt „geeignet“ sind, den „öffentlichen Frieden“ zu stören (z. B. Leugnung des Holocaust). Der Vergleich mündet in die Frage, ob und inwieweit die deutsche Meinungsfreiheit „amerikanisiert“, also entfesselt werden sollte. Jedem Versuch, darauf zu antworten, liegt ein politisches Vorverständnis von Demokratie und Konfliktbereitschaft zugrunde. Wie werden Debattenräume gedacht: risikofreudig weit oder vorsichtshalber etwas enger? Einerlei, zu welcher Seite das eigene Rechtsgefühl in diesem Spannungsfeld neigen mag: Zwischen dem deutschen Verständnis von Meinungsfreiheit und Freedom of Speech liegen Welten, die zu entdecken sich lohnt.
Dr. Horst Meier, geb. 1954, Autor & Jurist (www.horst-meier-autor.de). Studium in Göttingen. 1992 promoviert mit einer Arbeit über die Verbotsurteile gegen SRP und KPD. Zunächst Strafverteidiger, seit 1992 freier Autor. 2008 bis 2010 Studienleiter für Recht & Politik an der Evangelischen Akademie Hofgeismar. 2005 und 2017 Pressepreis des Deutschen Anwaltvereins, 2006 Regino-Preis der Neuen Juristischen Wochenschrift (für Deutschlandfunk-Sendungen zu Folter-Debatte, Parteienfreiheit und Feindstrafrecht).
Veröffentlichungen (Auswahl):
- 2012: Protestfreie Zonen? Variationen über Bürgerrechte und Politik (Essayband I). Berliner Wissenschaftsverlag
- 2017: Das zweite Verbotsverfahren gegen die NPD. Analyse, Prozessreportage, Urteilskritik. Recht & Politik, Beiheft 1. Berlin: Duncker & Humblot
- 2019: Nach dem Verfassungsschutz. Plädoyer für eine neue Sicherheitsarchitektur der Berliner Republik (mit Claus Leggewie). 2. Aufl. Berlin: Hirnkost.
- 2022: Politische Einheit im Dissens. Variationen über Bürgerrechte und Politik (Essayband II). Baden-Baden: Nomos
Autor & Jurist
Website: www.horst-meier-autor.de