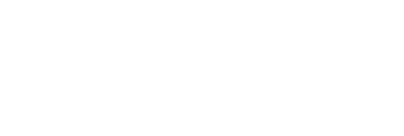Vorlesungen
„Wie steht’s mit dem, was in der Welt man Lieben heißt? –
Es ist das Schönste, Kind, und auch das Schmerzlichste.“
Euripides: ‚Hippolytos‘
Phaidra im Gespräch mit ihrer Amme
Vom Gelingen und Misslingen, von Lust und Begehren, von Sehnsucht und Freiheit – ist nicht alles schon über die Liebe erzählt worden? Ja, vielleicht, und gerade deshalb sind Sie eingeladen zum Erkunden der Selbst- und Paarliebe, der Verbindung von Anima und Animus in der Beziehung, zur Reflektion der Mutter- und Vaterliebe, des Liebens jenseits der Geschlechtergrenzen, der unerwiderten, verschmähten, vergifteten Liebe, und zur Begegnung mit Eros und Thanatos in der Übertragungsliebe. Lassen Sie uns gemeinsam über die Lebensspanne herausfinden, wie und ob es jemals ein gutes Ende für eine Beziehung geben kann …
Anhand historischer und gegenwärtiger Liebes- und Paarkonstellationen, an Mythen und Märchen schauen wir auf das Spannungsfeld zwischen Erotik und Sexualität, Bindung und Individualität unter psychodynamischem Aspekt.
- Hantel-Quitmann, W.: Der Geheimplan der Liebe; Herder-Verlag, 2007
- Schmidtbauer, W.: Die schnelle und die langsame Liebe; Gräfe und Unzer, 2023
- Kast, V.: Paare. Wie Phantasien unsere Liebesbeziehungen prägen; Kreuz-Verlag, 2009
- Kirchhoff, B.: Verlangen und Melancholie; dtv, 2016
- Ovid: Metamorphosen; Anaconda-Verlag, 2016
Schuld- und Schamkonflikte sind ein häufiger Fokus in der psychodynamischen Psychotherapie, insbesondere bei allen Selbstwertstörungen. In der Vorlesung soll auf die Grundlagen der Über-Ich- und Ich-Ideal-Entwicklung eingegangen werden. Schuldbindungen in Dyaden und Familien wie auch familiäre Faktoren der Schamvulnerabilität wie Familiengeheimnisse, Kranke und Außenseiter, verleugnete Täter, Grenzüberschreitungen, doppelte familiäre Wirklichkeiten sollen betrachtet werden. Bei den Schuldgefühlen spielen Basisschuldgefühle, Trennungs- und traumatische Schuld in der Klinik eine große Rolle. Diese sollen den adaptiven Funktionen der Schuld gegenübergestellt werden. Neben den selbstentwertenden Seiten der Schamattacken werden im therapeutischen Prozess vor allem die konstruktiven Seiten der Scham für die Kohärenz im Selbstgefühl, für Adaptationsprozesse im Selbstwert und interpersonelle Anerkennungsprozesse bearbeitet.
In der Vorlesung werden psychoanalytische Theorien des Denkens und der Repräsentation vorgestellt (Freud, Bion, Laplanche, Fonagy/Target), mit besonderem Blick auf die Rolle unbewusster Prozesse. Außerdem wird erörtert, wann von Störungen des Denkens gesprochen werden kann, wie sich diese in klinischen Prozessen äußern und wie mit ihnen gearbeitet werden kann.
- Storck, T. & Billhardt, F. (2021). Denken und Lernen. Stuttgart: Kohlhammer.
- Storck, T. & Stegeman, D. (2021). Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung. Stuttgart: Kohlhammer.
Zu Beginn einer Behandlung leiden hilfesuchende Personen oftmals darunter, das Vertrauen an ihre eigenen Bewältigungsstrategien verloren zu haben und sind demoralisiert. Gut gemeinte „positive“ Tipps der Fachpersonen können die Überzeugung nicht verstanden zu werden und alleine gelassen zu sein zusätzlich verstärken. Diese Hoffnungslosigkeit kann die Personen daran hindern, erste Veränderungen zu erkennen und an den kleinen und feinen Dingen anzusetzen. Die Vorlesung bietet eine theoretische Einführung und praktische Sensibilisierung über mögliche Chancen aber auch Schwierigkeiten, die sich bei der Umsetzung ressourcenorientierter Vorgehensweisen ergeben können.
Ziele der Vorlesung:
Es werden therapeutische Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch eine breite Diagnostik der individuellen Ressourcen und damit verbundene Interventionen für die Therapie genutzt werden können. Theoretische Aspekte werden anhand praktischer Beispiele und Übungen dargestellt und vertieft:
• Positiver Affekt differenzieren
• Ressourcenorientierte Hypothesenbildung
• Ecogramm und Lebenspanorama erstellen
• Ressourcenorientierte Beziehungsgestaltung
• Verbesserungen herausarbeiten und therapeutisch nutzen
- Frank, R. & Flückiger, C. (2021). Therapieziel Wohlbefinden (4. Aufl.). Berlin: Springer
- Flückiger, C. et al. (2023). Strength-based methods. Psychotherapy Research. (open access) https://doi.org/10.1080/10503307.2023.2181718
In Deutschland wachsen ungefähr drei bis vier Millionen Kinder und Jugendliche mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil auf (Wiegand-Grefe, & Petermann, 2016). Diese Kinder haben ein erhöhtes Risiko, selbst psychische Probleme zu entwickeln (z. B. Wiegand-Grefe et al., 2019), welches zum einen auf eine erhöhte genetische Vulnerabilität, zum anderen auf Umweltvariablen wie das elterliche Erziehungsverhalten zurück zu führen ist. Eltern mit psychischen Störungen haben häufig Schwierigkeiten, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. Eine Vielzahl von Studien hat in den vergangenen Jahren das Erziehungsverhalten von Eltern mit unterschiedlichen psychischen Störungen untersucht (für einen Überblick z. B. Reupert & Mayberry, 2016). Aspekte wie fehlendes Wissen über kindliche Grundbedürfnisse, Defizite in der Emotionsregulation und Schwierigkeiten im Umgang mit Stress und Konflikten können störungsübergreifende Probleme im Umgang von psychisch kranken Eltern mit ihren Kindern sein (z. B. Crandall, Deater-Deckard, & Riley, 2015). Die Vorlesung gibt einen Überblick über Schwierigkeiten von Eltern mit psychischen Störungen und die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Es werden unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt, die an verschiedenen Aspekten ansetzen und auf die Verbesserung der elterlichen Erziehungskompetenz, der kindlichen Entwicklung oder der Eltern-Kind-Interaktion ansetzen.
- Crandall A, Deater-Deckard K, Riley AW. (2015). Maternal emotion and cognitive control capacities and parenting: A conceptual framework. Dev Rev 1 (36), 105-126. doi: 10.1016/j.dr.2015.01.004.
- Reupert, A. & Maybery, D. (2016). What do we know about families where parents have a mental illness? A systematic review, Child & Youth Services, 37 (2), 98-111, DOI: 10.1080/0145935X.2016.1104037
- Wiegand-Grefe, S., Sell, M., Filter, B. & Plass-Christl, A. (2019). Family Functioning and Psychological Health of Children with Mentally Ill Parents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (7), 1278.
Ist Psychotherapie eine Kunstform? Ist Kunst therapeutisch? Wo kann die Psychotherapie von den Künsten profitieren? Seit Freud und Jung wird die enge Verbindung dieser beiden Zugänge zum Innerseelischen immer wieder zum Gegenstand psychotherapeutischer Reflexion und auch in der zeitgenössischen Psychotherapiewissenschaft kommt es zu fruchtbaren Schnittstellen. Die Vorlesung beschäftigt sich dabei nur am Rande mit der Kunsttherapie im engeren Sinne sondern will vielmehr – als Erweiterung psychotherapeutischer Denk- und Handlungsräume – die Befassung mit Kunst und Künstlerischem für die alltägliche psychotherapeutische Arbeit aufbereiten. Praxisnahe Überlegungen zu konkretem therapeutischen Handeln runden dieses Plädoyer für eine kunstinspirierte Psychotherapie ab.
Wenn Kinder oder Jugendliche nicht mehr leben wollen, werden bei allen Bezugspersonen starke Ängste und Überforderungserleben ausgelöst. Ähnlich erleben sich Therapeuten im Behandlungssetting. Umso wichtiger ist es für Behandler, einen sicheren Umgang mit Suizidalität zu erlangen. Ein wichtiger Schritt ist die Entwicklung einer klaren inneren Haltung, Gelassenheit und Handlungsmöglichkeiten. Die Begleitung parasuizidaler, latent suizidaler oder suizidaler Jugendlicher ist herausfordernd für das eigene therapeutische Seelenerleben. Gleichzeitig sind die betroffenen Familien in Krisen und benötigen unsere haltgebende Unterstützung und Führung durch die stürmischen Zeiten. Beim erfolgreichen Behandlungsfortschritt oder durch medikamentöse Einflüsse entstehen Hindernisse und Rückschläge wie Entfremdungserleben, Identitätsstörungen oder Suizidversuche, welche im therapeutischen Setting aufgefangen werden können. Eine intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Verlaufsoptionen und eigene Haltungsklärung gibt den therapeutischen Interventionen Sicherheit und verbessert die Compliance und den Verlauf.
In der Vorlesung wird auf das Arbeiten unter Einbezug von Übertragung und Gegenübertragung in unterschiedlichen psychotherapeutischen Verfahren (analytische PT, tiefenpsychologisch fundierte PT), Methoden (TFP, MBT) und Settings (ambulant, stationär) geblickt. Es wird der Vorschlag eines methodisch geleiteten Vorgehens aus Diagnostik und Intervention gegeben, das für unterschiedliche Arbeiten des Arbeitens angepasst werden kann.
- Storck, T. (2024). Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung. Göttingen: Hogrefe.
- Storck, T. (2021). Übertragung. Stuttgart: Kohlhammer
In dieser Vorlesung werden zunächst grundlegende Kenntnisse der Mentalisierungstheorie vermittelt. Dabei liegen die Schwerpunkte der Darstellung auf der Bedeutung der Bindungstheorie und des Konzepts des so genannten epistemischen Vertrauens, i.e. des basalen Vertrauens in eine Person als sichere Informationsquelle, als zwei der zentralen Bestandteile der Theorie und Praxis der Mentalisierungstheorie und -praxis. Darauf aufbauend wird diskutiert, welchen Beitrag Mentalisierung bei Traumatisierung und Bindungsstörungen leisten kann.
- Bateman A, Fonagy P (2016) Mentalization-Based Treatment for Personality Disorders. Oxford Press, Oxford
Unabhängig von der theoretischen Ausrichtung einer Psychotherapie ist heute davon auszugehen, dass Beziehungsaspekte von besonderer Bedeutung für deren Wirkung sind, auch wenn diese sicher nicht die alleinigen Wirkfaktoren sind. Ausgehend von den Befunden der Bindungstheorie und ihren Erweiterungen, denen zufolge man die Bindungsentwicklung als Basis für die interpersonalen Merkmale einer Person betrachten kann, werden in der Vorlesung Aspekte der therapeutischen Beziehung diskutiert und insbesondere geklärt, welche interpersonalen Kompetenzen psychotherapeutisch Tätige eigentlich benötigen, wie diese Kompetenzen erworben und gepflegt werden können und was geschehen kann, wenn diese Kompetenzen eingeschränkt sind. Ein wichtiges Thema wird die psychotherapeutische „Responsivität“ sein, also die Modifikation der Beziehungsgestaltung in Abhängigkeit von Patient:innenmerkmalen und dem Psychotherapieprozess
- Rief, W., Schramm, E., Strauß, B. (2021). Psychotherapie – Ein kompetenzorientiertes Lehrbuch. München: Elsevier
- Strauß, B. & Schauenburg, H. (Hrsg.). (2017). Bindung in Psychologie und Medizin. Grundlagen, Klinik und Forschung – Ein Handbuch. Stuttgart: Kohlhammer.
Die effektivsten Ansätze bei chronischen Schmerzen beinhalten immer schmerzpsychotherapeutische Ansätze, die in ein interdisziplinäres Behandlungssetting eingebettet sind. Sie werden in dieser Vorlesung die häufigsten Schmerzsyndrome näher kennenlernen und einen konkreten und praxisorientierten Einblick in die Vielfalt der schmerz-psychotherapeutischen Methoden erhalten, mit allen Besonderheiten in der Diagnostik und Behandlung dieser immer größer werdenden Patientengruppe. Die Indikationen für die unterschiedlichen Behandlungszweige im ambulanten und (teil-)stationären Sektor werden mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt. Dabei soll auch ein Überblick über die derzeitige Versorgungslandschaft entstehen und Ihnen Möglichkeiten zur Kooperation und Weiterbildung aufgezeigt werden. Neue Forschungsergebnisse werden mit praktischen Erfahrungen verknüpft, die auch durch kurze gemeinsame Übungen und ausreichend Diskussionsmöglichkeiten gemeinsam vertieft werden sollen.
- Von Wachter M., Hendrischke A. (Hrsg). Psychoedukation bei chronischen Schmerzen. Springer 2016.
- Kröner-Herwig B. et al. (Hrsg) Schmerzpsychotherapie. Grundlagen, Diagnostik, Krankheitsbilder, Behandlung. 8. Aufl Springer 2016.
- Nobis H.-G. et al. (Hrsg). Schmerz - eine Herausforderung. Springer 2016.
- www.schmerzgesellschaft.de
- www.dgpsf.de
Patienten mit komorbidem pathologischem Sorgen und generalisierter Angststörung (GAS) werden oftmals als ausschließlich depressive Patienten fehlinterpretiert. Da GAS-Patienten relativ gut auf die medikamentöse Depressions-Behandlung ansprechen, wird diese Fehlinterpretation in der Praxis oftmals nicht erkannt. Für die Psychotherapie kann sich die nicht erkannte Sorgenproblematik jedoch ungünstig auswirken, so dass die Patienten ein suboptimales psychotherapeutisches Angebot erhalten (wie beispielsweise suboptimale Psychoedukation, Verstärkung der Nervosität durch den schnellen Aufbau „angenehmer“ Tätigkeiten).
Ziele der Vorlesung:
Sorgenspezifische Interventionen wie Psychoedukation, Sorgentagebuch oder Imagery exposure mit Schwerpunkt in Kognitiver Verhaltenstherapie kennen. Flexible Individualisierung und Adaption von Nicht-verhaltenstherapeutischen Interventionen in die individuelle Fallkonzeption.
- Flückiger, C. & Schauenburg, H. (Eds.) (2022). Angststörungen. Psychotherapie im Dialog. Stuttgart: Thieme.
- Flückiger et al. (2023). (2022). The relative efficacy of bona fide cognitive behavioral therapy and applied relaxation for generalized anxiety disorder at followup: A longitudinal meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology. https://doi.org/10.1037/ccp0000717
Aufstellungsarbeit hat wie kaum ein anderes szenisches Verfahren fachliche Kontroversen ausgelöst und gleichzeitig eine starke Verbreitung im Praxisalltag von BeraterInnen und TherapeutInnen erfahren. Inzwischen gibt es eine große Vielfalt unterschiedlicher Vorgehensweisen und Anwendungsbereiche. In der Vorlesung werden theoretische und praktische Grundlagen dieser Arbeitsweise vorgestellt.
Themen werden u. a. sein:
- Geschichte und Entwicklungen der Aufstellungsarbeit
- Szenische Verfahren und Besonderheiten von Systemaufstellungen
- Vorgehensweisen im Einzel- und Gruppensetting
- Chancen, Risiken und Wirkungen
Bitte beachten Sie: Im Rahmen der Vorlesung gibt es die Möglichkeit für Erfahrungsaustausch und Fragen. Für Übungen und Selbsterfahrungssequenzen sei auf den Kurs 402 „Gut aufgestellt?“ Ein Praxisseminar zur Arbeit mit Aufstellungen und mit szenischen Elementen“ hingewiesen.
Es werden epidemiologische, sozialpsychologische, ethische und insbesondere psychodynamische Aspekte von Suizidalität und Suizid beleuchtet. Auf die Problematik des assistierten Suizids wird besonders eingegangen. Anhand von Fallbeispielen wird ein psychodynamisch orientiertes Konzept zur Krisenintervention vorgestellt.
- Henseler, H. Narzisstische Krisen. Zur Psychodynamik des Selbstmords. 4. aktualisierte Auflage, Westdeutscher Verlag 2000.
- Küchenhoff, J., Teising, M. (Herausgeber) Sich selbst töten mit Hilfe anderer. Psychosozial Verlag 2022.
Queere Personen, die hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Geschlechtsidentität von der Mehrheitsgesellschaft abweichen, treffen bei Therapeut:innen oft auf wenig Verständnis bzw. werden von Ihnen ungern in Behandlung genommen. Queere Personen stellen eine Herausforderung für uns dar, da sie uns mit Lebensformen konfrontieren, auf die wir in der therapeutischen Ausbildung nicht vorbereitet worden sind und auf die sich unsere therapeutischen Konzepte nur begrenzt anwenden lassen. Gerade darin liegt aber die große Chance, indem diese Patient:innen uns helfen, bisherige – enge – Denkräume zu öffnen, was für uns alle ein Gewinn ist.
- U. Rauchfleisch (2021): Sexuelle Orientierungen und Geschlechtsentwicklungen im Kindesalter. Kohlhammer.
- Redaktionsteam Jahrestagung der DPG Weimar 2023 (Frühjahr 2024): Jenseits der Binarität – Sexualitäten in der Herausforderung. (darin: U. Rauchfleisch: Nichtbinarität. Was resultiert daraus für die psychoanalytische Psychotherapie?)
- U. Rauchfleisch (2011): Schwule. Lesben. Bisexuelle. Lebensweisen, Vorurteile, Einsichten. 4. Aufl. Vandenhoeck & Ruprecht
Durch die klassischen Beziehungsform der Ehe oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft weht ein frischer Wind und Alternativen wie Polyamorie, Swinger-Beziehungen und andere Beziehungsvarianten drängen ans Licht. Hat die Monogamie ausgedient, ja ist sie sogar aufgrund ihrer Vorurteile eine Zumutung?
Forschungsdaten zeigen, dass Untreue eine stabile Größe in Beziehungen ist und auch deshalb (scheinbar) immer mehr Ehen geschieden werden. Die Zahl der Trennungen in eheähnlichen Verbindungen und Lebensgemeinschaften wird dabei als noch höher eingeschätzt. Die durchschnittliche Haltbarkeit liegt bei ca. 4 Jahren. Gleichzeitig wünschen sich über 80 % aller Personen zwischen 19 und 49 Jahren in Befragungen eine romantische Beziehung.
Vor welchen Herausforderungen stehen Liebenden in der Postmoderne, in der Treue neu verhandelt werden muss und darf? Sind Selbstliebe, Empathie, ToM und Achtsamkeit die zentralen Basisvariablen für gelingende Beziehungsgestaltung? Kann eine säkularisierte meditative Praxis hierzu einen Beitrag leisten? Und wie können wir diese Begriffe einordnen und entsprechende Techniken entwickeln für die Beratung und Therapie von Paaren? Wie können kommunikative Prozesse zu den unterschiedlichen Standpunkten sinnvoll therapeutisch begleitet und unterstütz werden?
Diesen Fragen soll nachgegangen und das kritische Denken genutzt werden, nicht um Antworten zu finden, sondern den eigenen Vorstellungsraum auszuleuchten und die darin wohnenden Einstellungen zu öffnen für andere Perspektiven und Möglichkeiten.
Es sollen sowohl Erkenntnisse aus Literatur und Forschung referiert werden, als auch ganz eigene Erfahrungswerte aus jahrelanger Therapie- und Beratungspraxis für Paare.
- Schott, Oliver (2020). Lob der offenen Beziehung: Über Liebe, Sex, Vernunft und Glück. Sexual politics 1. Bertz + Fischer
- Metzinger, T. (2023). Bewusstseinskultur. Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise. Berlin Verlag
- Scobel, G. & Gabriel, M. (2021). Zwischen Gut und Böse. Philosophie der radikalen Mitte. Edition Körber
Die Vorlesung wird die Facetten und die Ausprägungsgrade von Störungen im Bereich des Selbstwert-Systems beleuchten und soll dabei helfen, Patientengeschichten unter diesem Blickwinkel besser verstehen zu können. Zunächst wird die „normale“ Entwicklung des Selbst und des Selbstwertsystems dargestellt. Neben der (phänomenologischen) Unterscheidung von normalem und pathologischem Narzissmus liegt der zweite Schwerpunkt darauf, den psychodynamischen Blick für narzisstische Störungsanteile, deren Störanfälligkeiten und deren Regulations- / Kompensationsmechanismen zu schärfen und zu erweitern. Dem Referenten ist hierbei wichtig, dass das gesamte Spektrum narzisstischer Störungsbilder beleuchtet und einfühlbar wird - von der narzisstischen Depression (mit ihrem häufig rigiden, selbstanklagenden, bis zum Masochismus reichenden Über-Ich) bis hin zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung (mit ihrer, sich doch gänzlich anders präsentierenden Pathologie). Fallbeispiele werden die Störungsmuster illustrieren, auch werden gesellschaftliche Bezüge hergestellt (Wie begegnet uns „Narzisstisches“ im täglichen Leben?). Auf behandlungstechnische Besonderheiten wird ebenfalls eingegangen, wie auch auf die Besonderheiten beim weiblichen Narzissmus. Die Vorlesung ist schulenübergreifend konzipiert, d. h., auch nicht-psychodynamisch arbeitende Kolleginnen und Kollegen können von den Inhalten profitieren.
Psychoanalytikerin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in eigener Praxis, Dozentin, Supervisorin und Lehrtherapeutin
E-Mail: mail@praxis-becker.info
FA für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalytiker (DPV), Nervenarzt, Ehem. Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus, Dresden
E-Mail: peter.joraschky@uniklinikum-dresden.de
Psychologischer Psychotherapeut (AP/TP), Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin
E-Mail: t.storck@phb.de
Psychologischer Psychotherapeut VT, Ordinarius und Co-Leiter der Hochschulambulanz der Uni Kassel; Mitglied: American Psychological Association (APA), Society of Psychotheapy Research (SPR)
Ermächtigungen: PT für Erwachsene (CH/D)
E-Mail: christoph.fluckiger@uni-kassel.de
Psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin (VT), Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Health and Medical University Erfurt, Anger 66-73, 99084 Erfurt
E-Mail: charlotte.rosenbach@hmu-erfurt.de
Psychologischer Psychotherapeut, Tiefenpsychologe, Verhaltenstherapeut und Psychoanalytiker, Mitgliedschaften: DGPT, IAAP, Honorarprofessor für Psychoanalyse und Psychotherapie an der HfBK Dresden, Privatpraxis für Psychotherapie und Supervision in Ingolstadt
E-Mail: ralft.vogel@web.de
FÄ für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (TP) Chefärztin Median Kinderklinik Bereich Psychosomatik „Am Nikolausholz“, Mitglied am Institut für Psychotherapie und Angewandte Psychoanalyse Jena, Multifamilientherapeutin DGSF, Klinische Erfahrung in Kindergruppentherapie, intendiert psychodynamischer Gruppentherapie, DBT-A, MBT-A, Hypnotherapie, Supervisorin, Weiterbildungsermächtigung für Kinder- und Jugendpsychotherapie In Ausbildung zur Balintgruppenleiterin
Psychoanalytikerin, tätig in eigener Praxis
E-Mail: Marie-LuiseAlthoff@web.de
Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Universitätsklinikum Jena, Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie, Stoystr. 3, 07740 Jena
E-Mail:bernhard.strauss@med.uni-jena.de
Website: www.mpsy.uniklinikum-jena.de/Institut.html
Psychologische Psychotherapeutin VT, Spezielle Schmerzpsychotherapeutin, Lindenallee 9, 99310 Arnstadt (Zweigpraxis: Schenkstraße 22, 07749 Jena).
E-Mail: kontakt@psychotherapie-richter.org
Psychotherapeutin in eigener Praxis. Leiterin des Wieslocher Instituts für systemische Lösungen (WISL). Lehrtherapeutin und Supervisorin für Verhaltenstherapie, Systemische Therapie und Beratung (SG) und für Systemaufstellungen (DGfS). Fort- und Weiterbildungen in hypnosystemischen, humanistischen und tiefenpsychologischen Verfahren.
Fachrzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychoanalyse, Facharzt für Psychosomatische Medizin, Mitglied im DPV, DGPT, A. Mitscherlich Institut Kassel, Supervisor, Balintgruppenleiter, Selbsterfahrungsleiter, Psychoanalytische Privatpraxis in Bad Hersfeld
E-Mail: teising@t-online.de
Website: www.martin-teising.de
Psychoanalytiker, Private Praxis: Delsbergerallee 65, CH-4053 Basel
Mitgliedschaften: DPG, DGPT, FSP
E-Mail: info@udorauchfleisch.ch
Website: www.udorauchfleisch.ch
Psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis und Lehrpraxis für Verhaltenstherapie, Hypnotherapeutin (MEG), Supervisorin für VT und Plananalyse nach dem Berner Modell; Selbsterfahrungsleiterin; sexualtherapeutische Ausbildung im Sexocorporel.
E-Mail: info@praxis-jahn.com
Website: www.paar-kur.de
Facharzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapeut und Psychoanalytiker in eigener Praxis. Dozent, Lehranalytiker und Supervisor an verschiedenen psychotherapeutischen Ausbildungsinstituten. Weiterbildungsermächtigter Arzt der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz für die Bereichsbezeichnungen „Psychotherapie“ und „Psychoanalyse“.
Website: www.cherdron.com
E-Mail: praxis@cherdron.com